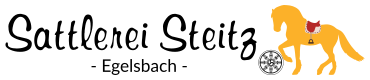Meine Arbeit als Sattler ist geprägt von Verantwortung – gegenüber dem Pferd, dem Reiter und einem fairen, ehrlichen Umgang. Doch leider zeigt sich in meiner täglichen Praxis oft ein anderes Bild. Wer meine Google-Bewertungen liest, erkennt schnell, wie viel Unverständnis und Druck es in der Branche geben kann.
Warum ich Auftragsanfragen auch ablehne
Eine fachlich begründete Einschätzung anhand technischer Daten wird nicht immer akzeptiert. Wird eine Anfrage abgelehnt, reagieren manche mit Unverständnis oder gar persönlichen Angriffen. Oft wird versucht, Kompetenz abzusprechen oder Druck auszuüben, bis hin zu Beleidigungen.
Wird ein Termin trotz Bedenken vereinbart, heißt es im Nachhinein schnell:
„Das hätten Sie vorhersehen müssen – und jetzt soll ich noch Anfahrtskosten bezahlen?“
Genau aus solchen Erfahrungen heraus habe ich klare Regeln und Abläufe definiert. Diese dienen dem Pferd, der Fairness im Umgang und einer professionellen Zusammenarbeit.
Typische Probleme in der Praxis
- Reitergewicht und Belastung – oftmals werden unrealistische Angaben schöngefärbt oder von Dritten unkritisch bestätigt.
- Haltung und Management – Pferde ohne Bewegung, ohne Koppel oder Paddock, unterstützt durch Stallbetreiber.
- Trainingsmethoden – Trainer, die einen härteren Umgang fordern, statt pferdegerechtes Reiten zu fördern.
- Fremdanpassungen – Kollegen, die Sättel anpassen oder verkaufen, obwohl Maße und Weiten nicht stimmen – Hauptsache Umsatz.
- Verdeckte Missstände – Probleme werden im Stall abgeschottet, sodass niemand das Pferdeleid mitbekommt.
Hier stellt sich eine zentrale Frage: Wo beginnt Misshandlung?
Sicherlich nicht nur bei einer überforderten Reiterin im Leistungsstress oder einer schlechten Trainerin. Es beginnt viel früher – bei falschen Vorbildern, fehlender Verantwortung und dem Wegsehen im Alltag.
Einen lesenswerten Überblick bietet auch die Welttierschutzorganisation zum Thema Pferde.
Meine Verantwortung als Sattler
Ich nehme meine Aufgabe sehr ernst:
- Jeder Sattel wird gründlich geprüft und nur dann angepasst oder verkauft, wenn er wirklich zum Pferd passt.
- Meine Zusammenarbeit basiert auf klaren Regeln – sie sind das Fundament für nachhaltige Lösungen.
- Ich entscheide bewusst, mit welchen Reitern und Ställen ich arbeite. Der respektvolle Umgang mit Pferden, Einstellern, Dienstleistern und Personal ist für mich ein wichtiges Kriterium.
Wer mit mir zusammenarbeiten möchte, ist herzlich eingeladen – unter der Voraussetzung, dass meine Regeln akzeptiert werden. Nur so ist eine verantwortungsvolle und erfolgreiche Arbeit am Pferd möglich.
Fazit
Nicht jede Anfrage führt automatisch zu einem Auftrag. Manchmal ist es für alle Beteiligten besser, zu verzichten, als einen falschen Weg einzuschlagen.
Ich erwarte hier Respekt für meine Entscheidung – im Sinne des Pferdes und einer fairen Zusammenarbeit.
Mehr dazu: Das Problem mit vielen Sattelbäumen.