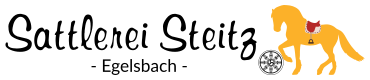Was bedeutet „tailliertes Kopfeisen“ oder „taillierter Sattelbaum“?
Ein tailliertes Kopfeisen erinnert mich immer an ein eng geschnürtes Korsett. Für Bodenarbeit oder freie, gesunde Bewegung ist das aus meiner Sicht ungeeignet.
Bei solchen Sätteln steht oft der Reiterwunsch nach einem schmalen Sitz im Vordergrund. Das Pferd muss sich anpassen – auch wenn seine Schulter- und Trapezfreiheit eingeschränkt wird.
Gerade bei Sätteln mit fest vernietetem Kopfeisen zeigt sich oft: Diese sind zu stark geweitet, um überhaupt noch zu passen. Die Veränderungsmöglichkeiten solcher Systeme sind sehr begrenzt. Man kann sie sich wie eine Glocke vorstellen – nur der Rand lässt sich etwas anpassen, am Kopf selbst passiert kaum etwas. Doch gerade dort, wo sich das Schulterblatt bewegt, liegt das Problem: Die Taillierung behindert die Bewegung. Oft kommen noch wulstige Kissen dazu, die im Trapezbereich wie ein Bremsklotz wirken. Die Folge: Rumpfabsenkung und Trageerschöpfung.
Beim Auflegen eines Kopfeisens am Pferd und mit etwas Vorstellungskraft für die Bewegung wird die Problematik deutlich sichtbar.



Der bessere Weg:
Ein gerader, tragfähiger Verlauf des Kopfeisens im passenden Winkel. Die Kissen sollten am Ende des Ortgangs weich und tragend aufliegen, nach oben hin auslaufen und keine Bewegung behindern.
Für Laien ist es oft schwer zu erkennen, ob ein Sattel ungeeignet ist. Auch ein zu kurzer oder instabiler Ortgang gehört dazu. Häufig findet man den sogenannten Wäscheklammereffekt: eine ständige Spannung im vorderen Sattelbereich, die sich im angegurteten Zustand kaum erkennen lässt.
Literaturhinweis:
Weiß, Eberhard: Medizinische Sattellehre, Georg Olms Verlag AG, 2013, S. 205, Abb. 29.
Weiterer Lesestoff: